Theoretiker_innen
Auf dieser Seite finden Sie alle Theoretiker_innen, sortiert in einer alphabetischen Reihenfolge. Wählen Sie aus der unten stehenden Liste einfach die Person aus, zu der Sie mehr erfahren möchten, bzw. dessen Interview Sie sich anschauen möchten.
A

Bringfriede Scheu & Otger Autrata
Bringfriede Scheu (*1957) ist Sozialwissenschaftlerin und Hochschullehrerin. Sie studierte Erziehungswissenschaft in der Studienrichtung Sozialpädagogik an der Universität Tübingen und promovierte dort 1989 zum Dr. der Sozialwissenschaften mit dem Thema Jugend auf dem Land. Scheu lehrt als Professorin an der Fachhochschule Kärnten in Feldkirchen/Österreich. Sie war Leiterin des Studienganges Soziale Arbeit und Studienbereichsleiterin des Studienbereiches Gesundheit und Soziales. Ihre Lehr- und Forschungsschwerpunkte sind Theorie Sozialer Arbeit, das Soziale und die Soziale Arbeit, Grundlagenforschung zum Sozialen und Theoriebildung Sozialer Arbeit.
Otger Autrata (*1955) studierte an der Tübinger Universität Pädagogik und promovierte dort zum Dr. rer. soc. im Arbeitsbereich Pädagogische Psychologie. Er habilitierte an der Universität Osnabrück und ist dort Privatdozent. Autrata leitet das private Rottenburger-Feldkirchner Forschungsinstitut für subjektwissenschaftliche Sozialforschung (RISS). Seine Lehr- und Forschungsschwerpunkte sind Grundlagenforschung zum Sozialen als Gegenstand der Sozialen Arbeit sowie Theorie Sozialer Arbeit.
Scheu und Autrata haben ihre disziplintheoretischen Untersuchungen besonders in den Werken Soziale Arbeit. Eine paradigmatische Bestimmung (2008), Theorie Sozialer Arbeit. Gestaltung des Sozialen als Grundlage (2011) und Das Soziale. Gegenstand der Sozialen Arbeit (2018) vorgestellt.
Das Interview wurde am 05.09.2018 geführt
Sie finden hier folgende Videos:
[openVideo=fullvideo;Gesamtes Video]
[openVideo=Persönliches und Einstiegsfragen;Persönliches und Einstiegsfragen]
[openVideo=Kurzvorstellung;Kurzvorstellung]
[openVideo=Gegenstandsbestimmung/das Soziale/Grenzen des Sozialen;Gegenstandsbestimmung/das Soziale/Grenzen des Sozialen]
[openVideo=Autonomie der Sozialen Arbeit/Expertin des Sozialen/Denomination/Material vs Formalbezug;Autonomie der Sozialen Arbeit/Expertin des Sozialen/Denomination/Material vs Formalbezug]
[openVideo=Warum sollte die Soziale Arbeit mit Ihrer Theorie arbeiten? - Ein konkretes Beispiel;Warum sollte die Soziale Arbeit mit Ihrer Theorie arbeiten? - Ein konkretes Beispiel]
[openVideo=Gemeinschaftsbegriff/Kritik an den bisherigen Gegenstandsbestimmungen;Gemeinschaftsbegriff/Kritik an den bisherigen Gegenstandsbestimmungen]
[openVideo=Forschung/Lebensqualität/Normativer Bezug;Forschung/Lebensqualität/Normativer Bezug]
[openVideo=Herausforderung/Leittheorie/Demograph. Entwicklung/Singularisierung/Dequalifizierung/Perspektive der eigenen Theorie;Herausforderung/Leittheorie/Demograph. Entwicklung/Singularisierung/Dequalifizierung/Perspektive der eigenen Theorie]
B

Lothar Böhnisch
Lothar Böhnisch (*1944 - †2024) studierte von 1963 bis 1965 Geschichte, Volkswirtschaft und Politologie an der Universität Würzburg und von 1965 bis 1969 Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Nach dem Studienabschluss war er vier Jahre am Deutschen Jugendinstitut als wissenschaftlicher Referent tätig und leitete danach bis 1981 den Forschungsbereich Jugendhilfe/Jugendpolitik. Böhnisch promovierte 1977 (Politische Dimensionen sozialpädagogischer Analyse) an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen bei Hans Thiersch. Dort habilitierte er 1982 (Der Sozialstaat und seine Pädagogik. Sozialpolitische Anleitungen zur Sozialarbeit). Ab dieser Zeit war er in Tübingen als Privatdozent und später als Professor tätig. Er wurde auf einer Außenstelle des Deutschen Jugendinstituts (DJI) am Institut für Erziehungswissenschaft an der Universität Tübingen tätig und baute den Arbeitsschwerpunkt der Landjugend- und Regionalforschung auf. 1991 erhielt Böhnisch einen Lehrstuhl als Gründungsprofessor für Sozialpädagogik und Sozialisation der Lebensalter an der erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Technischen Universität Dresden. Seit 1991 ist Böhnisch regelmäßig in Graz und Wien sowie als Gastprofessur an der Universität Bologna und an der Universität Bozen tätig. Im Jahr 2009 wurde Böhnisch emeritiert. Seit 2008 ist er Kontraktprofessor an der Fakultät für Bildungswissenschaften der Universität Bozen.
Das Interview wurde am 07.03.2019 geführt
Sie finden hier folgende Videos:
[openVideo=fullvideo;Gesamtes Video]
[openVideo=Persönliches und Einstiegsfragen;Persönliches und Einstiegsfragen]
[openVideo=Kurzvorstellung;Kurzvorstellung]
[openVideo=Wissenschaftliche Gegenstandsbestimmung;Wissenschaftliche Gegenstandsbestimmung]
[openVideo=Lebensbewältigung/Beispiele der Lebensbewältigung/Funktionale Äquivalente;Lebensbewältigung/Beispiele der Lebensbewältigung/Funktionale Äquivalente]
[openVideo=Milieubildung (Offen/geschlossen);Milieubildung (Offen/geschlossen)]
[openVideo=Digitalisierung/Virtuelle Welt in Jugendsozialarbeit und Schulsozialarbeit;Digitalisierung/Virtuelle Welt in Jugendsozialarbeit und Schulsozialarbeit]
[openVideo=Empowerment/soziale Nachhaltigkeit/Vernetzung in der Sozialen Arbeit;Empowerment/soziale Nachhaltigkeit/Vernetzung in der Sozialen Arbeit]
[openVideo=Herausforderungen für die Soziale Arbeit/Soziale Arbeit in der heutigen Gesellschaft;Herausforderungen für die Soziale Arbeit/Soziale Arbeit in der heutigen Gesellschaft]
[openVideo=Grenzen der Sozialen Arbeit/Doppeltes Mandat von Hilfe und Kontrolle;Grenzen der Sozialen Arbeit/Doppeltes Mandat von Hilfe und Kontrolle]
G & H

Wilfried Hosemann & Wolfgang Geiling
Wilfried Hosemann (*1948) ist Dipl.-Pädagoge und Dipl.-Sozialarbeiter. Hosemann promovierte zum Dr. phil. an der Freien Universität Berlin mit dem Thema Trebegänger und Verwahrloste in sozialpädagogischer Betreuung außerhalb von Familie und Heim. Er lehrte als Professor für Soziale Arbeit (Theorie und Sozialpädagogische Familienberatung) am Fachbereich Soziale Arbeit an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg und der Hochschule Coburg. Seine Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte sind: Supervision und Methoden der Sozialen Arbeit sowie soziale Gerechtigkeit. Hosemann wurde 2013 emeritiert.
Wolfgang Geiling (*1969) ist Dipl.-Sozialpädagoge (FH), Dipl.-Pädagoge (Univ.), Systemischer Familientherapeut (DGSF), Supervisor (DGSv) und Lehrender für Systemische Therapie und Beratung (DGSF). Geiling promovierte 2019 an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg mit der Dissertation zum Thema Systemische Schulsozialarbeit – theoretische und professionelle Klärungen. Geiling lehrte an verschiedenen Hochschulen und in Anstellungen als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Seine Arbeitsschwerpunkte sind: Kinder- und Jugendhilfe im Kooperationsfeld Bildung und Erziehung, Systemische Beratung im schulischen Kontext, Schulsozialarbeit, Theorien, Konzepte und Methoden Systemischer Sozialer Arbeit.
Hosemann und Geiling haben ihre theoretische Konzeption Sozialer Arbeit besonders in der Neufassung ihres erstmals in 2005 erschienenen Buches Einführung in die Systemische Soziale Arbeit (2013) dargelegt.
Das Interview wurde am 09.10.2018 geführt
Sie finden hier folgende Videos:
[openVideo=fullvideo;Gesamtes Video]
[openVideo=Persönliches und Einstiegsfragen;Persönliches und Einstiegsfragen]
[openVideo=Kurzvorstellung;Kurzvorstellung]
[openVideo=Markierung der eigenen Theorie;Markierung der eigenen Theorie]
[openVideo=Kritik und Forschung als Kern der Sozialen Arbeit;Kritik und Forschung als Kern der Sozialen Arbeit]
[openVideo=Gesellschaftstheoretische Fundierung und Reflexivität;Gesellschaftstheoretische Fundierung und Reflexivität]
[openVideo=Herausforderungen für die Soziale Arbeit;Herausforderungen für die Soziale Arbeit]
K
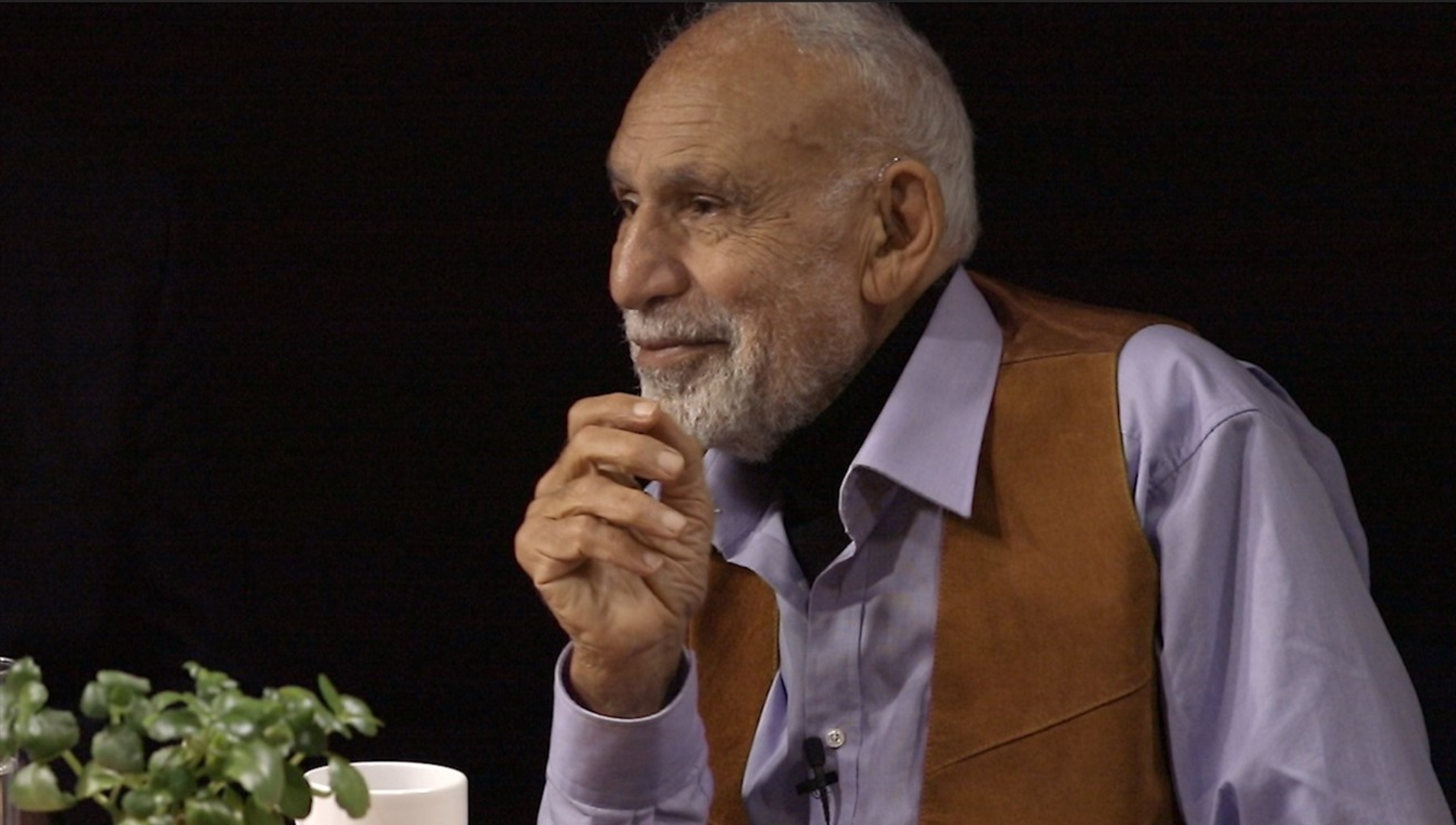
Karam Khella
Karam Khella (*1934, +2022) studierte in Kairo Theologie und Sprachwissenschaften. Im Rahmen eines Austauschprogramms für Dozenten kam Khella 1958 an die Universität Hamburg. Khella promovierte 1968 zum Dr. phil. an der theologischen Fakultät der Universität Kiel mit der Arbeit Dioskoros I. von Alexandrien: Theologie und Kirchenpolitik. Er war in der Lehre an den Universitäten Bremen, Hamburg, Stuttgart und Marburg sowie zahlreichen europäischen und außereuropäischen Universitäten tätig. In den Jahren 1971 bis 1982 war Khella an dem Aufbau und der Lehre eines sozialpädagogischen Zusatz- und Aufbaustudiums an der Universität Hamburg beteiligt. Dieses Studium, das zu keinem berufsqualifizierenden Abschluss führte, wurde 1982 aus dem Lehrangebot gestrichen.
Khellas Schaffen dreht sich nicht schwerpunktmäßig um die Sozialarbeit und Sozialpädagogik. Seine diesbezüglichen Publikationen standen besonders im Kontext seiner Zeit als Dozent im sozialpädagogischen Zusatzstudium der Universität Hamburg. Hier sind vor allem seine Theorie und Praxis der Sozialarbeit und Sozialpädagogik (1980) und ein fünfbändiges Handbuch der Sozialarbeit und Sozialpädagogik (1973–1983) zu nennen. Im Jahr 2008 hat Khella seine Begründung der Möglichkeit objektiver Erkenntnis noch einmal ausführlicher in seinem Buch Die universalistische Erkenntnis- und Geschichtstheorie dargelegt. Anders als noch in seiner früheren dialektisch-materialistischen Position geht er heute nicht mehr vom Primat der Ökonomie sondern der Politik aus. Dazu beschreibt Khella die Spaltung unserer Welt in mehrfacher Hinsicht. Reichtum und Armut seien nur eine skandalöse Form dabei. Das ist ein Problem für die Sozialarbeit. Staat, Kirche und Verbände sind mit den konkreten Problemen konfrontiert, ohne wirksame Lösungen zu haben. Um die Spaltung zu verstehen, müssten wir erkennen, dass wir im Kapitalismus leben, der diese Probleme schafft. Der Staat gibt keine ausreichenden Hilfen, denn er stellt sich dem Grundproblem nicht. Aus seiner Sicht gibt es keine Korrektur.
Das Interview wurde am 10.11.2018 geführt
Sie finden hier folgende Videos:
[openVideo=fullvideo;Gesamtes Video]
[openVideo=Persönliches und Einstiegsfragen;Persönliches und Einstiegsfragen]
[openVideo=Kurzvorstellung;Kurzvorstellung]
[openVideo=Selbst gebautes Gefängnis;Selbst gebautes Gefängnis]
[openVideo=Soziale Arbeit von unten;Soziale Arbeit von unten]
[openVideo=Strukturelle vs. Psychische Probleme / Arbeiterklasse;Strukturelle vs. Psychische Probleme / Arbeiterklasse]
[openVideo=Primat der Politik / Freiheitskampf / Politisierung;Primat der Politik / Freiheitskampf / Politisierung]
[openVideo=Netzwerkarbeit;Netzwerkarbeit]
[openVideo=Herausforderungen anthropologischer Sozialer Arbeit;Herausforderungen anthropologischer Sozialer Arbeit]

Heiko Kleve
Heiko Kleve (*1969 ) studierte nach einer Ausbildung zum Facharbeiter für Datenverarbeitung in Berlin/Ost zu Beginn der 1990er Jahre über den zweiten Bildungsweg und schloss 1996 sein Studium der Sozialarbeit und Sozialpädagogik an der Alice-Salomon-Fachhochschule Berlin ab. Danach arbeitete er sechs Jahre als Sozialarbeiter in der ambulanten Erziehungshilfe und der Sozialpsychiatrie. Begleitend studierte er Sozialwissenschaften mit den Schwerpunkten Soziologie, Politologie und Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin und promovierte 1998 im Fach Soziologie an der Freien Universität Berlin. Von 2002 bis 2005 war er Professor für Theorie und Geschichte Sozialer Arbeit an der Alice-Salomon-Hochschule Berlin und von 2005 bis 2017 Professor am Fachbereich Sozial- und Bildungswissenschaften der Fachhochschule Potsdam mit dem Schwerpunkt soziologische und sozialpsychologische Grundlagen der Sozialen Arbeit. Seit Juli 2017 ist Kleve Inhaber des Stiftungslehrstuhls für Organisation und Entwicklung von Unternehmerfamilien am Wittener Institut für Familienunternehmen, Fakultät für Wirtschaftswissenschaft, Universität Witten/Herdecke.
Kleves postmoderne, systemtheoretisch-konstruktivistisch orientierte Grundlegungen Sozialer Arbeit sind insbesondere zu finden in den Büchern: Postmoderne Sozialarbeit (1998, 2007), Die Sozialarbeit ohne Eigenschaften. Fragmente einer postmodernen Professions- und Wissenschaftstheorie; Sozialer Arbeit (2000), Sozialarbeitswissenschaft, Systemtheorie und Postmoderne. Grundlegungen und Anwendungen eines Theorie- und Methodenprogramms (2003) und Konstruktivismus und Soziale Arbeit: Einführung in Grundlagen der systemisch-konstruktivistischen Theorie und Praxis (2008).
Das Interview wurde am 27.08.2019 geführt
Sie finden hier folgende Videos:
[openVideo=fullvideo;Gesamtes Video]
[openVideo=Persönliches und Einstiegsfragen;Persönliches und Einstiegsfragen]
[openVideo=Kurzvorstellung;Kurzvorstellung]
[openVideo=Soziale Arbeit ohne Eigenschaften, Lebensführung, Postmoderne;Soziale Arbeit ohne Eigenschaften, Lebensführung, Postmoderne]
[openVideo=Warum sollte Soziale Arbeit mit Ihrer Theorie arbeiten?;Warum sollte Soziale Arbeit mit Ihrer Theorie arbeiten?]
[openVideo=Ambivalenz / Soziale Arbeit Selbstbeschreibung;Ambivalenz / Soziale Arbeit Selbstbeschreibung]
[openVideo=Autonomie der Profession / Entpolitisierung;Autonomie der Profession / Entpolitisierung]
[openVideo=Ökonomisierung / Neoliberalismus / Finanzierung;Ökonomisierung / Neoliberalismus / Finanzierung]
[openVideo=Herausforderungen / Digitalisierung / Migration / Wissenschaftsdiskurs;Herausforderungen / Digitalisierung / Migration / Wissenschaftsdiskurs]

Björn Kraus
Björn Kraus (*1969) war Hauptschüler und Hilfsarbeiter im Sägewerk. Nach verschiedenen Ausbildungen und Tätigkeiten in Gewerbe und Handwerk gelangt er auf dem zweiten Bildungsweg zum Studium. Er studierte in Ludwigshafen Soziale Arbeit (Dipl.-Sozialpädagoge) und Erziehungswissenschaft in Landau. In Freiburg schloss er ein Masterstudium Management und Didaktik von Bildungsprozessen ab. Im Rahmen seiner Promotion zum Dr. phil. an der Universität Heidelberg arbeitete er die intersystemische Perspektive des Radikalen Konstruktivismus heraus und legte die Grundlagen einer Lebenswelt-Lebenslagen-Orientierten Sozialen Arbeit (systemisch-konstruktivistischen Lebensweltorientierung). Davon ausgehend entwickelte er in den 2000er und 2010er Jahren den Relationalen Konstruktivismus auf dessen Basis er im Rahmen seiner Habilitation an der Universität Kassel die Grundlagen einer Theorie der Relationalen Arbeit entfaltet.
Weitere Ausbildungen absolvierte er als Systemischer Therapeut und Berater (SG), Systemischer Supervisor (SG) und Systemischer Coach (SG) sowie Supervisor und Coach (DGSv). Praktische Erfahrungen sammelt er u.a. in der offenen Jugendarbeit, in der stationären Jugendhilfe und als Leiter eines städtischen Kinder- und Jugendbüros.
2005 wurde Kraus auf eine Professur für Sozialarbeitswissenschaft an der Evangelischen Hochschule Freiburg berufen und hat dort seit 2012 die neu gegründete Profilprofessur Wissenschaft Soziale Arbeit inne. Kraus zählt zu den Protagonisten konstruktivistischer Theorienentwicklung im Allgemeinen und der Entwicklung einer Wissenschaft Soziale Arbeit im Speziellen. Seine Schwerpunkte liegen sowohl in der Erkenntnis-, Kommunikations- und Machttheorie, als auch in Grundlagenfragen einer Wissenschaft Soziale Arbeit. Insbesondere seine Machttheorie und seine Lebenswelt-Lebenslage-Konzeption werden auch international und auch außerhalb der Sozialen Arbeit rezipiert..
Kraus steht für den Relationalen Konstruktivismus und eine Relationale Soziale Arbeit. Der aktuelle Stand seiner theoretischen Fundierung finden sich besonders in den beiden Werken Erkennen und Entscheiden. Grundlagen und Konsequenzen eines erkenntnistheoretischen Konstruktivismus für die Soziale Arbeit (2013) und Relationaler Konstruktivismus – Relationale Soziale Arbeit. Von der systemisch-konstruktivistischen Lebensweltorientierung zu einer relationalen Theorie der Sozialen Arbeit (2019).
Das Interview wurde am 03.01.2019 geführt
Sie finden hier folgende Videos:
[openVideo=fullvideo;Gesamtes Video]
[openVideo=Persönliches und Einstiegsfragen;Persönliches und Einstiegsfragen]
[openVideo=Kurzvorstellung;Kurzvorstellung]
[openVideo=Markierung der eigenen Theorie;Markierung der eigenen Theorie]
[openVideo=Bedeutung des vorgelegten Theorieangebotes - Teil 1;Bedeutung des vorgelegten Theorieangebotes - Teil 1]
[openVideo=Bedeutung des vorgelegten Theorieangebotes - Teil 2;Bedeutung des vorgelegten Theorieangebotes - Teil 2]
[openVideo=Bedeutung des vorgelegten Theorieangebotes - Teil 3;Bedeutung des vorgelegten Theorieangebotes - Teil 3]
[openVideo=Herausforderungen für die Soziale Arbeit;Herausforderungen für die Soziale Arbeit]
M

Tilly Miller
Tilly Miller (*1957) studierte Politikwissenschaft (Dipl.sc.pol.) an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Sozialpädagogik mit dem Schwerpunkt Jugend- und Erwachsenenbildung (Dipl. Sozialpädagogin) an der Fachhochschule München. Sie schloss eine Weiterbildung zur Theaterpädagogin BuT® ab sowie eine Weiterbildung in Tanz- und Bewegungspädagogik (Moderner Kreativer Tanz). Miller promovierte an der Universität der Bundeswehr München, Fakultät für Pädagogik mit dem Thema Komplexität und politische Erwachsenenbildung. Seit 1990 ist sie Professorin für Sozialarbeit/Sozialpädagogik und Politikwissenschaft an der Katholischen Stiftungshochschule München. Millers Arbeits- und Forschungsschwerpunkte sind: Netzwerkforschung, Netzwerktheorien, Netzwerkarbeit, Systemtheorie und systemische Soziale Arbeit, Erwachsenenbildung, Gruppen- und Teamentwicklung sowie Theaterarbeit.
Millers systemtheoretisch-konstruktivistisch orientierte und handlungstheoretisch weitergeführte Konzeption Sozialer Arbeit sind in den beiden Werken Systemtheorie und Soziale Arbeit. Entwurf einer Handlungstheorie (1999) sowie Inklusion - Teilhabe - Lebensqualität. Tragfähige Beziehungen gestalten. Systemische Modellierung einer Kernbestimmung Sozialer Arbeit (2012) dargelegt.
Das Interview wurde am 05.11.2018 geführt
Sie finden hier folgende Videos:
[openVideo=fullvideo;Gesamtes Video]
[openVideo=Persönliches und Einstiegsfragen;Persönliches und Einstiegsfragen]
[openVideo=Kurzvorstellung;Kurzvorstellung]
[openVideo=Systemtheorie als Schlüssel;Systemtheorie als Schlüssel]
[openVideo=Beziehungsarbeit als Gegenstand der Sozialen Arbeit/Inklusion/virtuelle Beziehungsarbeit;Beziehungsarbeit als Gegenstand der Sozialen Arbeit/Inklusion/virtuelle Beziehungsarbeit]
[openVideo=Herausforderungen für Theoriebildung / Gesellschaftliche Umbrüche;Herausforderungen für Theoriebildung / Gesellschaftliche Umbrüche]
[openVideo=Ethische Orientierung;Ethische Orientierung]
O
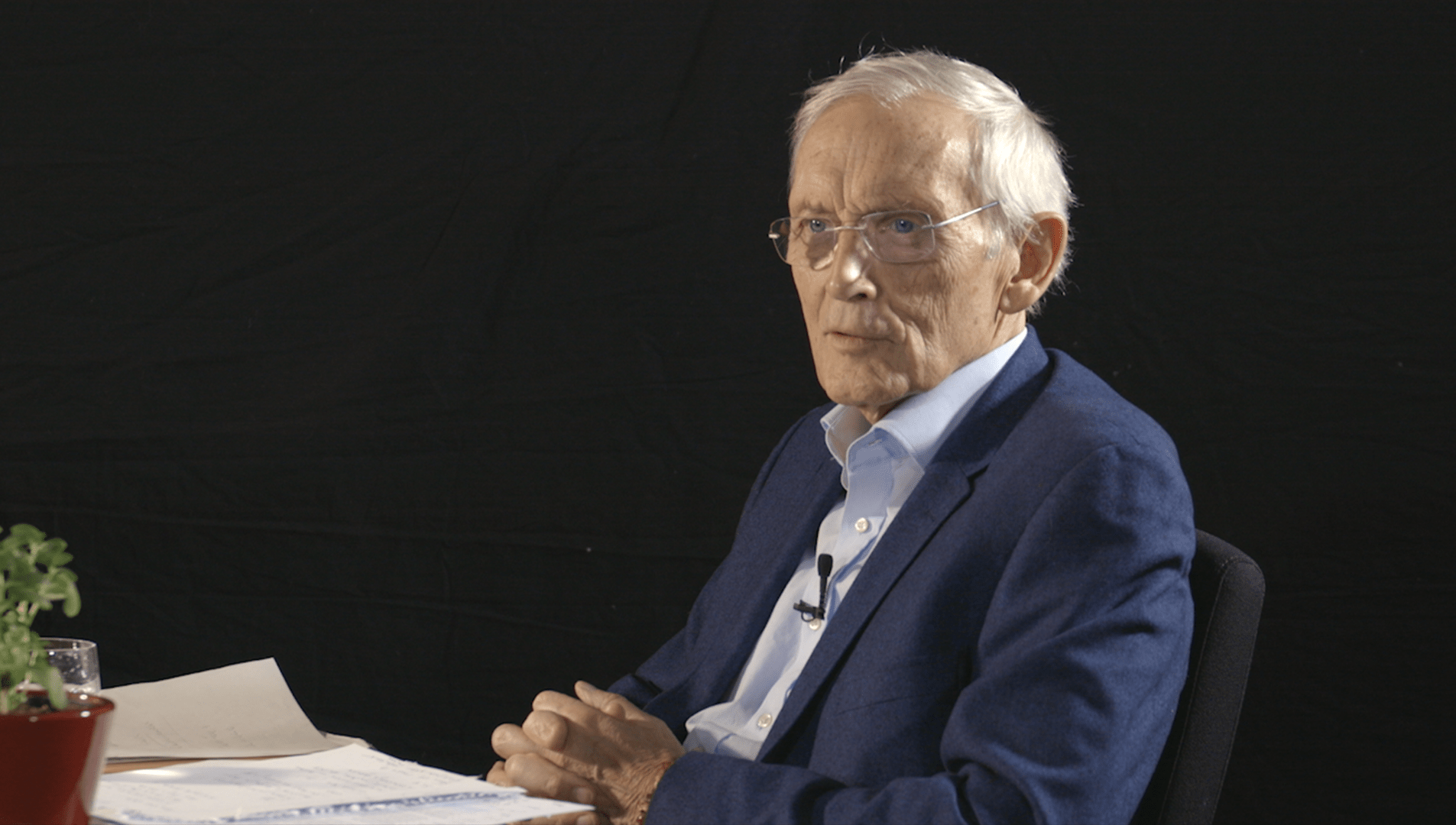
Hans-Uwe Otto
Hans-Uwe Otto (* 1940; +2020) besuchte nach einer Facharbeiterlehre als Maschinenschlosser in der Industrie und einer Tätigkeit u.a. in einem Stahlwerk die Höhere Fachschule für Sozialarbeit in Dortmund. Er war als Sozialarbeiter tätig und studierte Soziologie mit den Nebenfächern Pädagogik, Psychologie und Volkswirtschaft an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Nach einer ersten Tätigkeit als wissenschaftlicher Assistent an der Sozialforschungsstelle der Uni Münster in Dortmund wechselte er an die neu gegründete Universität Bielefeld. 1970 folgte ein einjähriger Forschungsaufenthalt am Indian Statistic Institute in Kalkutta sowie 1974 seine Promotion. Kurze Zeit später übernahm Otto eine Professur für Erziehungswissenschaft und Sozialpädagogik an der Pädagogischen Hochschule Westfalen-Lippe in Bielefeld. Ab 1978 war er in der gleichen Position an der Fakultät für Pädagogik der Universität Bielefeld tätig und entwickelte dort den Diplomstudiengang Soziale Arbeit in Lehre und Forschung weiter.
Otto war bis zu seinem Lebensende langjähriger Honorarprofessor (adjunct professor) an der School of Social Policy and Practice der University of Pennsylvania, Philadelphia, USA und – verbunden mit einer langfristigen Kooperation – außerordentlicher Professor an der Shanghai University, China. In verschiedenen Zeitabschnitten war er Gastprofessor an den Universitäten Chicago, Zürich, Blomfontein (South Africa). Er war Ehrendoktor der Universität Halle-Wittenberg, der Universität Dortmund, der University of Ioannina (Griechenland) und der State University St. Petersburg (Russland).
Otto war Mitgründer und Leiter des 2006 gegründeten Bielefeld Center for Education and Capabilities an der Universität Bielefeld und seit 2008 Senior Research Professor für soziale Dienste und Erziehungswissenschaft. Seine Forschungsschwerpunkte lagen von Anfang an in der kritischen Analyse der Jugendwohlfahrt in Deutschland und Europa und der Theorieentwicklung reflexiver Professionalität sozialer Dienste (zusammen mit Bernd Dewe) sowie in der Weiterentwicklung des Capability/-ies Approach. Bis zu seinem Lebensende forschte er im Bereich der grundsätzlichen Veränderung der Organisations- und Arbeitsbedingung der Sozialen Arbeit, die unter dem Druck einer neo-liberal umgesteuerten Sozialpolitik hervorgerufen wurden. Hierzu gehört vor allem eine kritische Auseinandersetzung mit der Einführung von Social Investment-Ansätzen, sowohl in ihren strukturellen als auch insbesondere individuellen Konsequenzen sowie die folgenreiche Reformulierung von Effizienz und Effektivität.
Das Interview wurde am 04.02.2019 geführt
Sie finden hier folgende Videos:
[openVideo=fullvideo;Gesamtes Video]
[openVideo=Persönliches und Einstiegsfragen;Persönliches und Einstiegsfragen]
[openVideo=Kurzvorstellung;Kurzvorstellung]
[openVideo=Wahl des Theorieansatzes;Wahl des Theorieansatzes]
[openVideo=Bedeutung institutionenkritischer und politischer Kern der Sozialen Arbeit;Bedeutung institutionenkritischer und politischer Kern der Sozialen Arbeit]
[openVideo=Ausrichtung an gesellschaftstheoretischen Positionen;Ausrichtung an gesellschaftstheoretischen Positionen]
[openVideo=Wirkungsraum der Sozialen Arbeit;Wirkungsraum der Sozialen Arbeit]
[openVideo=Praxiswissen und Wissenschaftswissen - Identität als Sozialarbeiter_in;Praxiswissen und Wissenschaftswissen - Identität als Sozialarbeiter_in]
[openVideo=Technizistisches Professionsverständnis und reflexive Sozialpädagogik;Technizistisches Professionsverständnis und reflexive Sozialpädagogik]
[openVideo=Kritisch-reflexive Sozialpädagogik und Capability Approach;Kritisch-reflexive Sozialpädagogik und Capability Approach]
[openVideo=Aktive Adressat_innenbeteiligung und Dienstleistungs-Partizipation;Aktive Adressat_innenbeteiligung und Dienstleistungs-Partizipation]
[openVideo=Empowerment-Begriff;Empowerment-Begriff]
[openVideo=Herausforderungen für die Soziale Arbeit;Herausforderungen für die Soziale Arbeit]
R
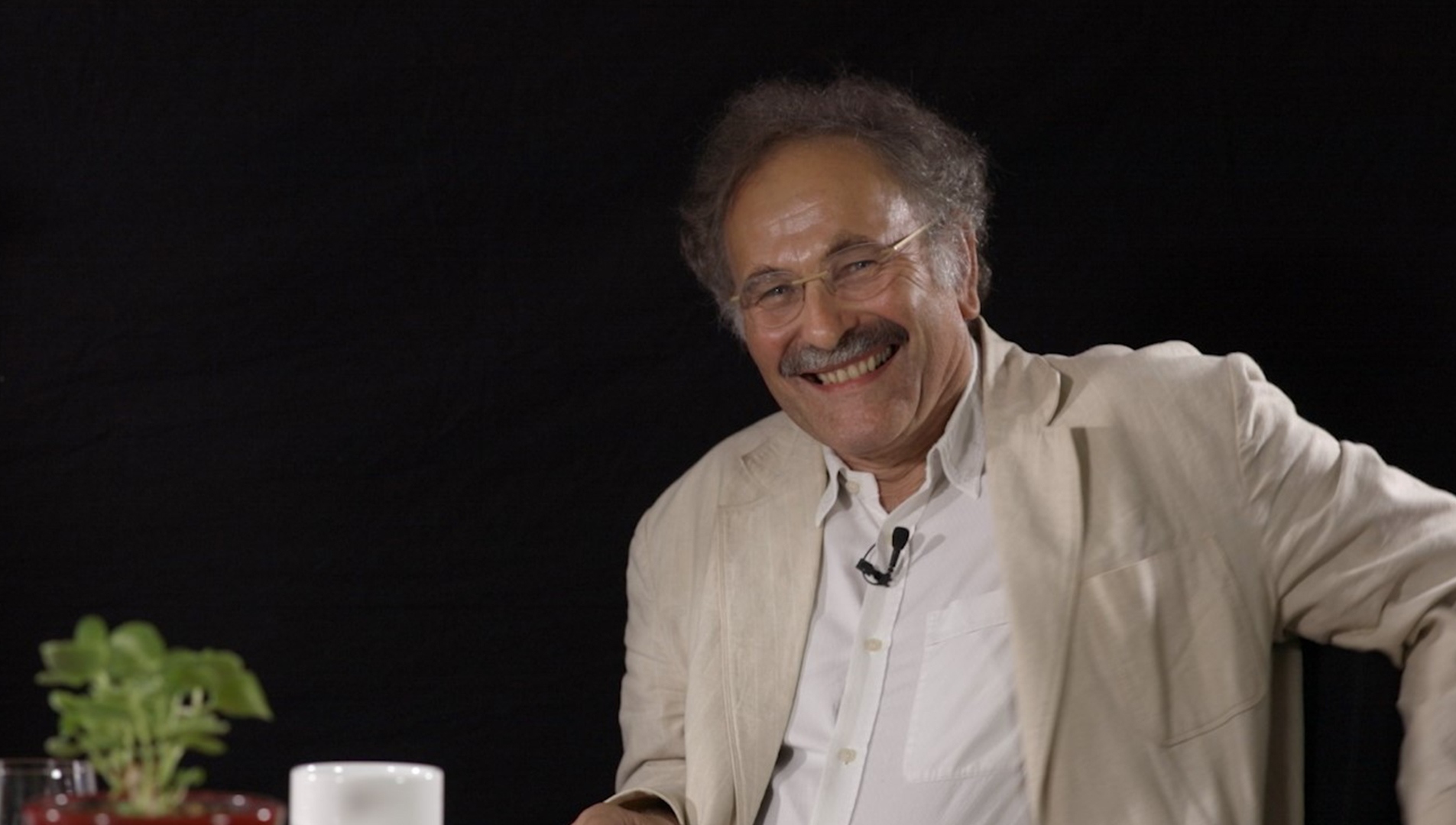
Wolf Ritscher
Wolf Ritscher (*1948) studierte von 1969 bis 1970 evangelische Theologie, Geschichte und Philosophie an der Ruhr-Universität Bochum und von 1972 bis 1982 an der Universität Heidelberg Pädagogik, Soziologie und Psychologie. Er promovierte 1979 an der Universität Heidelberg mit dem Thema Sozialisationstheoretische Voraussetzungen für eine Kritik der Pädagogik. Ritscher lehrte als Professor für Psychologie an der Hochschule für Sozialwesen in Esslingen mit den Schwerpunkten Klinische Psychologie, Familientherapie und Familiensozialarbeit. Seine Arbeits- und Forschungsschwerpunkte sind: Systemische Beratung/Therapie und ihr gesellschaftlicher Kontext, Geschichte der Systemischen Therapie und der Psychotherapie im Allgemeinen, die Verknüpfung systemischer, psychoanalytischer und humanistischer Verfahren und Gesellschaftstheorie, Systemische Soziale Arbeit und Beratung/Therapie in der Sozialen Arbeit, Kinder- und Jugendhilfe, Soziale Psychiatrie, Schulsozialarbeit, die psychosozialen Folgen des Nationalsozialismus und Bildungsarbeit an Gedenkstätten des nationalsozialistischen Terrors. 2011 wurde Ritscher emeritiert. Ritscher verfügt über eine Vielzahl von Zusatzausbildungen: Psychoanalytische Gruppendynamik, Psychodrama, Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie sowie Lehrtherapeut (Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie, Köln).
Ritscher hat seine theoriebasierte Konzeption Sozialer Arbeit hat Ritscher besonders in den Werken Einführung in die systemische Soziale Arbeit mit Familien (2006) und Soziale Arbeit: systemisch. Ein Konzept und seine Anwendung (2007) sowie Systemische Modelle für die Soziale Arbeit. Ein integratives Lehrbuch für Theorie und Praxis (2017) ausgeführt.
Das Interview wurde am 27.08.2019 geführt
Sie finden hier folgende Videos:
[openVideo=fullvideo;Gesamtes Video]
[openVideo=Persönliches und Einstiegsfragen;Persönliches und Einstiegsfragen]
[openVideo=Kurzvorstellung;Kurzvorstellung]
[openVideo=Psychologie / Soziale Arbeit;Psychologie / Soziale Arbeit]
[openVideo=Theorie oder Handlungskonzept;Theorie oder Handlungskonzept]
[openVideo=Ökologischer Ansatz / Praxisbeispiel;Ökologischer Ansatz / Praxisbeispiel]
[openVideo=Vier Imperative / Methoden, Technik;Vier Imperative / Methoden, Technik]
[openVideo=Geschulte Intuition;Geschulte Intuition]
[openVideo=Herausforderungen für die Soziale Arbeit;Herausforderungen für die Soziale Arbeit]
[openVideo=Konzept der Loyalität / Personelle Kontinuität;Konzept der Loyalität / Personelle Kontinuität]
[openVideo=Es gibt kein Wahrheitsmonopol / Zentraltheorie;Es gibt kein Wahrheitsmonopol / Zentraltheorie]
[openVideo=Unterschied von Beratung / Therapie;Unterschied von Beratung / Therapie]
[openVideo=Relevanz - Lebensweltorientierung;Relevanz - Lebensweltorientierung]
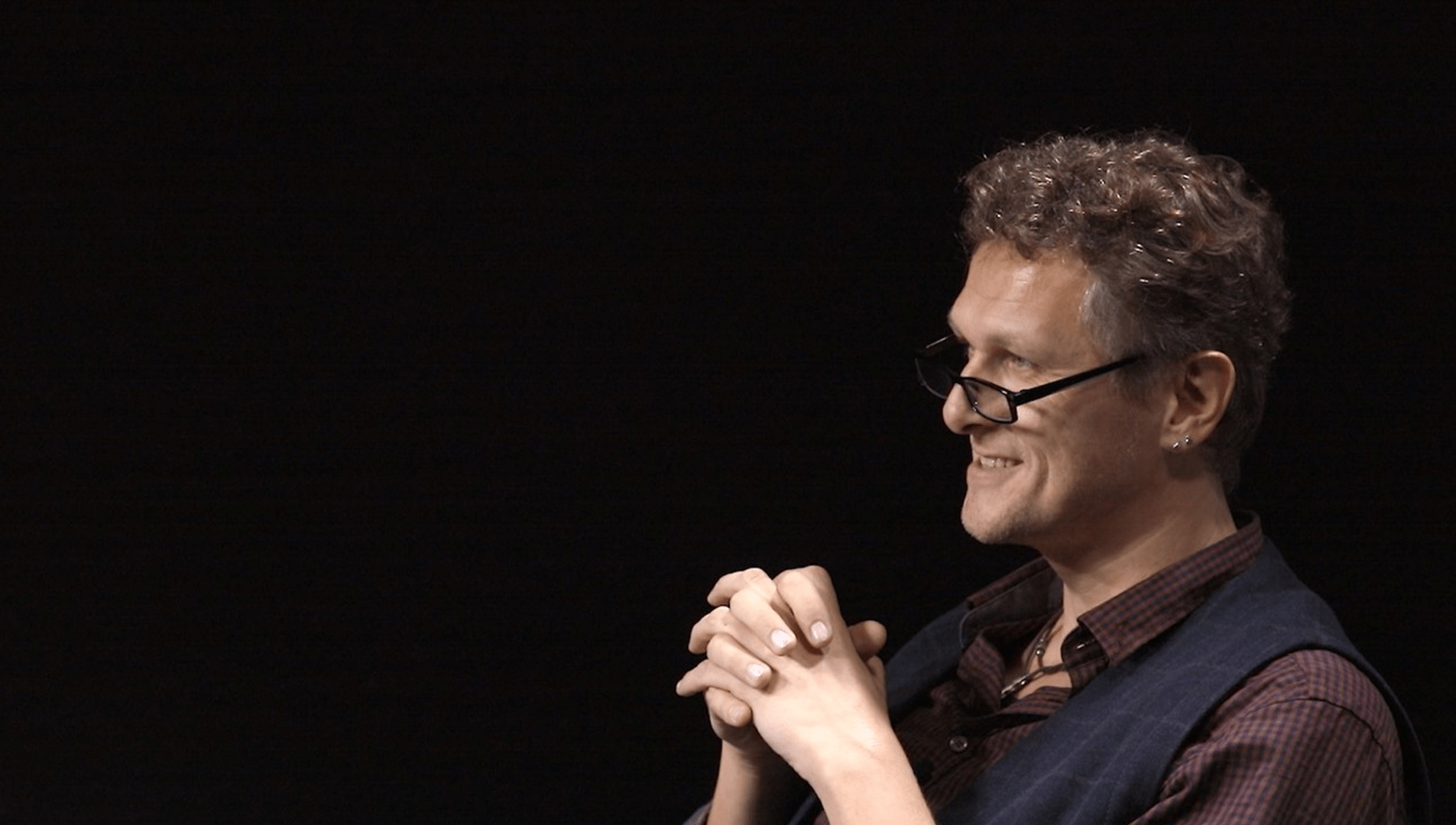
Dieter Röh
Dieter Röh (*1971) ist ein deutscher Sozialarbeitswissenschaftler und Gesundheitswissenschaftler. Nach seinem Abschluss als Diplom-Sozialarbeiter/Sozialpädagoge an der Fachhochschule Ostfriesland war er bis 2003 im sozialpsychiatrischen Bereich und in der Behindertenhilfe tätig. Von 2000 bis 2003 studierte Röh an der Fachhochschule Ostfriesland Praxisorientierte Interdisziplinäre Gesundheitswissenschaft und schloss dieses Studium 2003 mit dem Abschluss Master of Public Health (MPH) ab. Von 2003 bis 2005 folgte eine Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsschwerpunkt Entwicklung von Modellen und Standards der integrierten Versorgung im Bereich der Rehabilitation von Menschen mit motorischen Störungen. 2005 promovierte er zum Dr. phil. an der Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg mit dem Thema Empowerment als Hilfe zur Lebensbewältigung - Anforderungen an ein integratives Empowermentmodell für die Arbeit mit psychisch erkrankten Menschen in Zeiten postmoderner Gesellschaftsveränderungen. Seit 2005 ist Röh Professor für Sozialarbeitswissenschaft mit den Lehrschwerpunkten Geschichte, philosophische Grundlagen, Theorien und Methoden der Sozialen Arbeit an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Hamburg. Weiterhin ist Röh im Bereich sozialräumlicher Hilfen in der Behindertenhilfe und der Sozialpsychiatrie aktiv
Röh hat seine handlungstheoretische Konzeption Sozialer Arbeit besonders in seinem Werk Soziale Arbeit, Gerechtigkeit und das gute Leben. Eine Handlungstheorie zur daseinsmächtigen Lebensführung (2013) dargelegt.
Das Interview wurde am 10.11.2018 geführt
Sie finden hier folgende Videos:
[openVideo=fullvideo;Gesamtes Video]
[openVideo=Persönliches und Einstiegsfragen;Persönliches und Einstiegsfragen]
[openVideo=Kurzvorstellung;Kurzvorstellung]
[openVideo=Markierung der eigenen Theorie;Markierung der eigenen Theorie]
[openVideo=Bedeutung des vorgelegten Theorieangebotes - Teil 1;Bedeutung des vorgelegten Theorieangebotes - Teil 1]
[openVideo=Bedeutung des vorgelegten Theorieangebotes - Teil 2;Bedeutung des vorgelegten Theorieangebotes - Teil 2]
[openVideo=Herausforderungen für die Soziale Arbeit;Herausforderungen für die Soziale Arbeit]
S
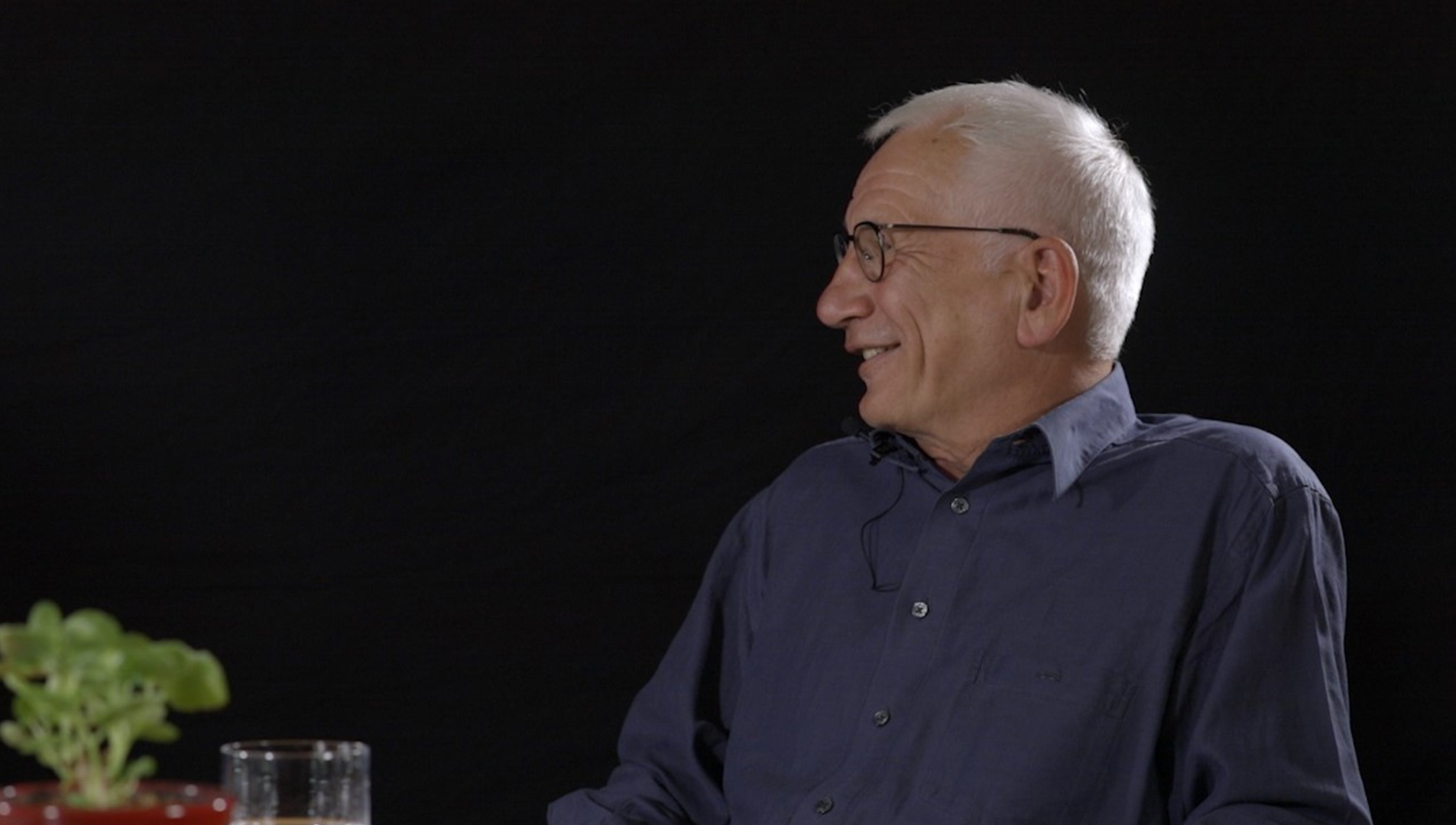
Albert Scherr
Albert Scherr (*1958) ist Soziologe und Sozialarbeitswissenschaftler. Nach dem Abitur studierte er von 1977 bis 1981 Soziologie und Pädagogik an der Universität Frankfurt. Nach seinem Studienabschluss als Diplom-Soziologe folgte von 1981 bis 1983 eine sozialpädagogische Berufstätigkeit in der offenen Jugendarbeit. 1984 promovierte er zum Dr. phil. am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Universität Frankfurt am Main mit dem Thema Strukturelle Bedingungen und alltagskulturelle Formen individueller Reproduktion im entwickelten Kapitalismus. Von 1990 bis 1999 war Scherr Professor für Soziologie und Jugendarbeit an der Fachhochschule Darmstadt. 1998 habilitierte Scherr an der Universität Karlsruhe (venia: Allgemeine Soziologie) und übernahm 2000 die Vertretung einer Professur an der Universität Koblenz-Landau. Seit 2001 ist Scherr Professor für Soziologie an der Pädagogischen Hochschule Freiburg und Direktor des Instituts für Soziologie. Albert Scherrs Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte umfassen Aspekte soziologischer Theorien, Theorien der Sozialen Arbeit, Migration, Diskriminierung, Rassismus, Rechtsextremismus, qualitativ-empirische Bildungsforschung und Bildungstheorie sowie Jugendforschung.
Das Interview wurde am 24.08.2019 geführt
Sie finden hier folgende Videos:
[openVideo=fullvideo;Gesamtes Video]
[openVideo=Persönliches und Einstiegsfragen;Persönliches und Einstiegsfragen]
[openVideo=Kurzvorstellung;Kurzvorstellung]
[openVideo=Soziale Probleme;Soziale Probleme]
[openVideo=Diffuse Allzuständigkeit;Diffuse Allzuständigkeit]
[openVideo=Semiprofessionalität;Semiprofessionalität]
[openVideo=Ausblick/Herausforderungen/Globalisierung/Lebensführung/Normative Wirkung;Ausblick/Herausforderungen/Globalisierung/Lebensführung/Normative Wirkung]

Werner Schönig
Werner Schönig (*1966) studierte Volkswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Sozialpolitik und Informatik an der Universität zu Köln und der Stockholm School of Economics (Handelshögskolan, Schweden) . Nach der Promotion zum Dr. rer. pol. war er als freiberuflicher Berater und Dozent sowie als wissenschaftlicher Assistent tätig und habilitierte sich für Sozialpolitik an der Universität zu Köln. Seit 2004 lehrt er als Professor im Fachbereich Sozialwesen der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen (NRW) an der Abteilung Köln und war Visiting Scholar an der New School for Social Resarch (New York) und der Universität Pittsburgh (PA). Seine Lehr- und Forschungsschwerpunkte sind Sozialökonomik und Konzepte der Sozialen Arbeit mit Arbeitsschwerpunkten in sozialen Diensten, Sozialraumorientierung, Armut und sozialökonomischen Fragestellungen. Schönig ist Gründungsmitglied und aktives Mitglied der Sektion Politik in der Deutschen Gesellschaft Soziale Arbeit (DGSA)
Sein rahmentheoretisches Verständnis Sozialer Arbeit hat Schönig in dem Werk Duale Rahmentheorie Sozialer Arbeit. Luhmanns Systemtheorie und Deweys Pragmatismus im Kontext situativer Interventionen (2012) vorgestellt. In seinen aktuellen Forschungszugängen zur Theoriebildung der Sozialen Arbeit fokussiert Schönig die Begriffe Dualität, Situation und Prozess und Widerspruch, welche er in ihrer Zusammenschau als grundlegend für die Theorieentwicklung ansieht. Von besonderer Bedeutung ist für ihn zudem die Frage nach der Ordnung der komplexen Vielfalt sozialer Probleme in Gestalt von Typologien.
Das Interview wurde am 17.12.2018 geführt
Sie finden hier folgende Videos:
[openVideo=fullvideo;Gesamtes Video]
[openVideo=Persönliches und Einstiegsfragen;Persönliches und Einstiegsfragen]
[openVideo=Kurzvorstellung;Kurzvorstellung]
[openVideo=Markierung der eigenen Theorie;Markierung der eigenen Theorie]
[openVideo=Bedeutung des vorgelegten Theorieangebotes;Bedeutung des vorgelegten Theorieangebotes]
[openVideo=Herausforderungen für die Soziale Arbeit;Herausforderungen für die Soziale Arbeit]

Peter Sommerfeld
Peter Sommerfeld (*1958) studierte Soziologie, Psychologie und Erziehungswissenschaft an den Universitäten Tübingen und Grenoble und promovierte zum Dr. rer. soc. an der Universität Tübingen mit dem Thema Erlebnispädagogisches Handeln. Seit 2006 lehrt und forscht er als Professor an der Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule für Soziale Arbeit (FHNW/HSA). Sommerfelds Lehr- und Forschungsschwerpunkte sind: Professionalisierung der Sozialen Arbeit, Theorien der Sozialen Arbeit (Systemtheorien) sowie Evidence-based Social Work, forschungsbasierte Praxisentwicklung, Betriebliche Soziale Arbeit, Soziale Arbeit in der Psychiatrie und Soziale Arbeit im Strafvollzug. Sommerfeld war an der Gründung der Schweizerischen Gesellschaft für Soziale Arbeit (SGSA) beteiligt und von 2006 bis 2015 ihr Co-Präsident. Weiterhin war er an der Gründung der European Social Work Research Association (ESWRA) beteiligt und ist dort seit deren Gründung 2012 Vorstandsmitglied.
Aus dem Forschungsprojekt zur Integration und Lebensführung sind unter der fachwissenschaftlichen Regie von Sommerfeld Umrisse einer Theorie der Sozialen Arbeit (2011) entstanden. Das Forschungsprojekt fand unter der Mitwirkung von Lea Hollenstein und Raphael Calzafferri als wissenschaftliche MitarbeiterInnen statt. Zu weiteren, arbeitsfeldspezifischen Ausarbeitungen der Theorie (Baumgartner; Sommerfeld 2016; Sommerfeld et al. 2016) haben diverse andere wissenschaftliche MitarbeiterInnen und KollegInnen einen Beitrag geleistet, so vor allem Edgar Baumgartner, Matthias Hüttemann, Regula Dällenbach und Cornelia Rüegger.
Das Interview wurde am 03.01.2019 geführt
Sie finden hier folgende Videos:
[openVideo=fullvideo;Gesamtes Video]
[openVideo=Persönliches und Einstiegsfragen;Persönliches und Einstiegsfragen]
[openVideo=Kurzvorstellung;Kurzvorstellung]
[openVideo=Zentrale Begriffe der Theorie - Teil 1;Zentrale Begriffe der Theorie - Teil 1]
[openVideo=Zentrale Begriffe der Theorie - Teil 2;Zentrale Begriffe der Theorie - Teil 2]
[openVideo=Autonomie der Sozialen Arbeit;Autonomie der Sozialen Arbeit]
[openVideo=Bedeutung der eigenen Theoriebildung - Teil 1;Bedeutung der eigenen Theoriebildung - Teil 1]
[openVideo=Bedeutung der eigenen Theoriebildung - Teil 2;Bedeutung der eigenen Theoriebildung - Teil 2]
[openVideo=Herausforderungen für die Soziale Arbeit;Herausforderungen für die Soziale Arbeit]
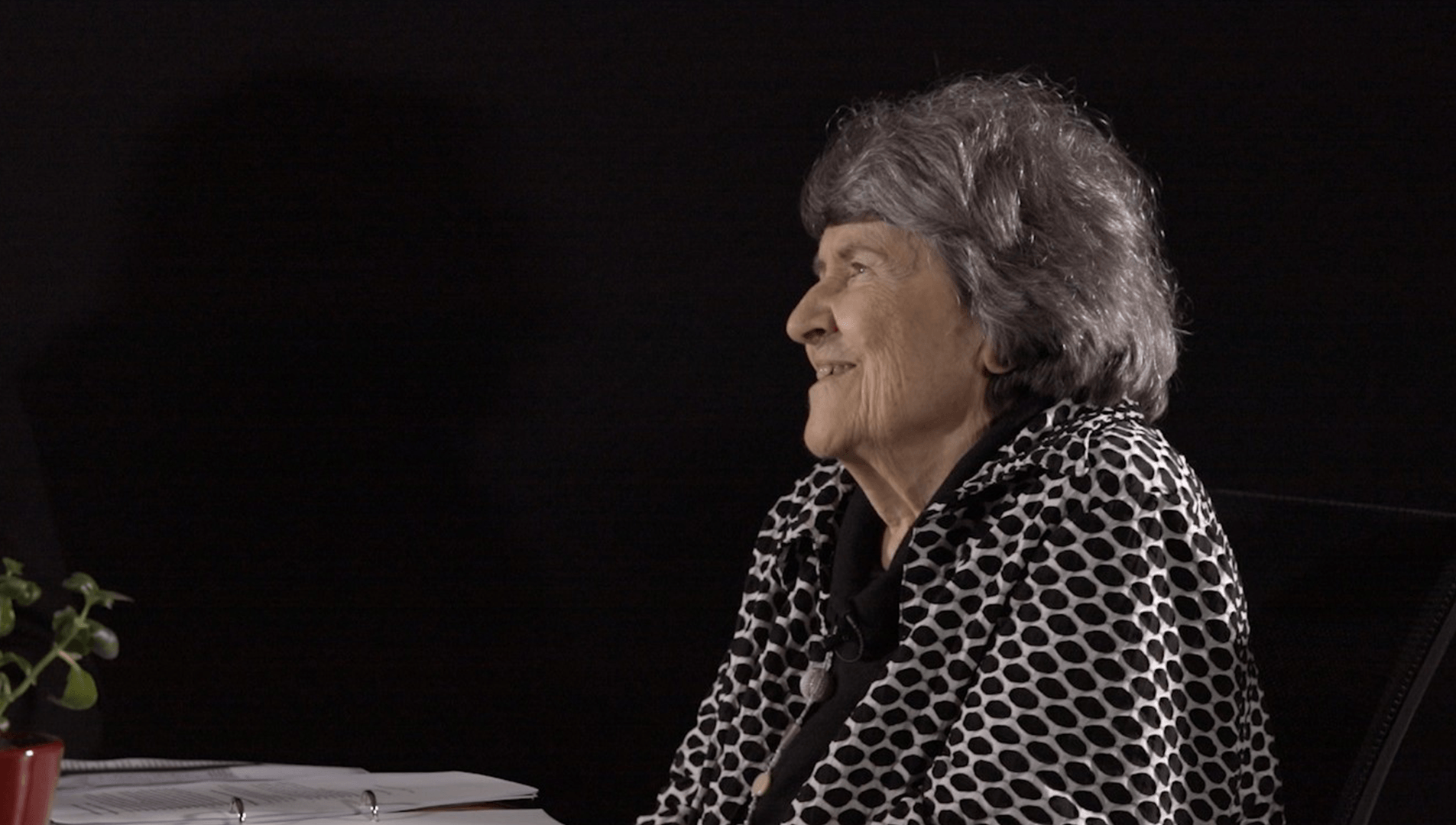
Silvia Staub-Bernasconi
Silvia Staub-Bernasconi (*1936) ist Diplom-Sozialarbeiterin, Soziologin und Sozialarbeitswissenschaftlerin. Nach Abschluss ihrer Ausbildung als Sozialarbeiterin an der Schule für Soziale Arbeit in Zürich studierte sie dank eines UNO-Stipendiums Social Work an der University of Minnesota in Minneapolis und an der Columbia University in New York. Praktische Erfahrungen als Sozialarbeiterin sammelte sie im Streetwork, im Sozialdienst, in der Lower East Side von New York (War on Poverty) und in der Migrationssozialarbeit. An der Schule für Soziale Arbeit in Zürich lehrte sie als Dozentin seit 1967. Ihr Studium der Soziologie, Sozialethik und Pädagogik schloss sie 1983 mit einer Promotion ab. 1996 habilitierte sie am Institut für Sozialpädagogik der Technischen Universität Berlin und erhielt dort 1997 eine Professur. Silvia Staub-Bernasconi ist seit 2003 emeritiert. Sie ist weiterhin national wie international aktiv und in unterschiedlicher Funktion in zahlreichen Gremien vertreten.
In einer Fülle von Publikationen hat Staub-Bernasconi ihre systemtheoretisch-ontologische Positionen zur Entwicklung einer Handlungswissenschaft Sozialer Arbeit und Sozialer Arbeit als Menschenrechtsprofession dargelegt. Bereits in ihrer Dissertation Soziale Probleme – Dimensionen ihrer Artikulation – Umrisse einer Theorie Sozialer Probleme als Beitrag zu einem theoretischen Bezugsrahmen Sozialer Arbeit (1983) hat sie ihre Theorieposition umrissen und in ihren Büchern: Systemtheorie, soziale Probleme und Soziale Arbeit: lokal, national, international oder: vom Ende der Bescheidenheit (1995), Soziale Arbeit als Handlungswissenschaft (2007) und der vollständig überarbeiteten Fassung Soziale Arbeit als Handlungswissenschaft – Auf dem Weg zu kritischer Professionalität (2018) vorgestellt und weiterentwickelt.
Das Interview wurde am 03.01.2019 geführt
Sie finden hier folgende Videos:
[openVideo=fullvideo;Gesamtes Video]
[openVideo=Persönliches und Einstiegsfragen;Persönliches und Einstiegsfragen]
[openVideo=Kurzvorstellung;Kurzvorstellung]
[openVideo=Vom Ende der Bescheidenheit. Am Anfang war Empörung;Vom Ende der Bescheidenheit. Am Anfang war Empörung]
[openVideo=Anknüpfungen an Systemtheorien;Anknüpfungen an Systemtheorien]
[openVideo=Soziale Arbeit, Macht und transformativer Dreischritt - Teil 1;Soziale Arbeit, Macht und transformativer Dreischritt - Teil 1]
[openVideo=Soziale Arbeit, Macht und transformativer Dreischritt - Teil 2;Soziale Arbeit, Macht und transformativer Dreischritt - Teil 2]
[openVideo=Soziale Arbeit, Macht und transformativer Dreischritt - Teil 3;Soziale Arbeit, Macht und transformativer Dreischritt - Teil 3]
[openVideo=Das Triplemandat und eine kleine Diskussion dazu;Das Triplemandat und eine kleine Diskussion dazu]
[openVideo=Herausforderungen für die Soziale Arbeit;Herausforderungen für die Soziale Arbeit]
T
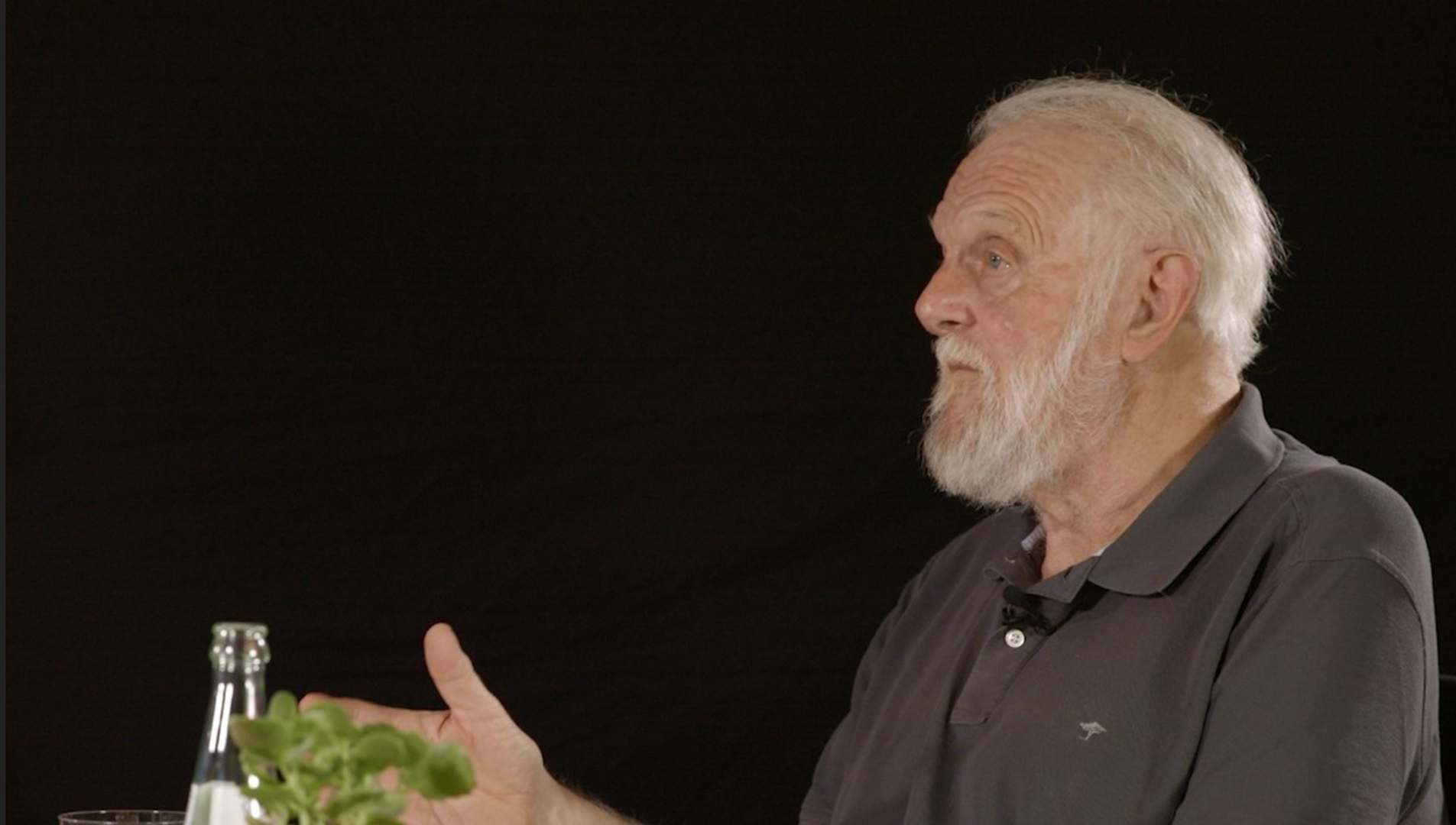
Hans Thiersch
Hans Thiersch (*1935) studierte an der Universität Göttingen und Germanistik, Philosophie und Theologie. Dort war er u. a. Schüler von Wolfgang Kayser, Walter Killy, Friedrich Gogarten und besonders von Erich Weniger. 1962 promovierte er an der Universität Göttingen mit einer Arbeit über „Jean Paul“. Danach wurde Thiersch Assistent von Heinrich Roth. 1967 heiratete Hans Thiersch Renate Hetzel und übernahm noch im selben Jahr eine Professur für Allgemeine Pädagogik an der Pädagogischen Hochschule in Kiel. 1979 wechselt er an die Universität Tübingen, die als erste Universität einen Diplomstudiengang im Fach Erziehungswissenschaft eingerichtet hatte. Innerhalb dieses Studienganges war die Sozialpädagogik ein eigener Studienschwerpunkt und wurde von Thiersch maßgeblich entwickelt. 1996 wurde ihm die Ehrendoktorwürde der Universitäten Dresden und Lüneburg verliehen.
Thiersch hat den alltags- und lebensweltorientierten Ansatz in die Soziale Arbeit gebracht. Eine Vielzahl von Monografien, Herausgeberschaften und Aufsätzen dokumentieren Thierschs bisherige reichhaltige Publikationstätigkeit. Seine theoretischen Grundlegungen sind insbesondere belegt in den Werken: Kritik und Handeln: interaktionistische Aspekte der Sozialpädagogik; gesammelte Aufsätze (1977), Alltagshandeln und Sozialpädagogik (1978), Die Entwicklung der Erziehungswissenschaft“ (zusammen mit U. Herrmann und H. Rupprecht, 1978), Die Erfahrung der Wirklichkeit. Perspektiven einer alltagsorientierten Sozialpädagogik (1986, 2006), Lebensweltorientierte Soziale Arbeit. Aufgaben der Praxis im sozialen Wandel (9. Aufl. 2014, 1992,), Deutsche Lebensläufe (zus. mit Walter Jens, 1987) Lebenswelt und Moral: Beiträge zur moralischen Orientierung sozialer Arbeit (1995) und Positionsbestimmungen der Sozialen Arbeit: Gesellschaftspolitik, Theorie und Ausbildung (2002), Sozialpädagogisches Denken. Wege zu einer Neubestimmung (zus. mit L. Böhnisch und W. Schröer, 2005), Spiegelungen, Lebensweltorientierung und Lebensbewältigung (zus. mit L. Böhnisch, 2014), Die Stimme der Adressatinnen (Hrsg. zus. mit M.Bitzan und E.Bolay ), Zur Identität der Sozialen Arbeit (Hrsg. zus. mit R.Treptow ), Praxishandbuch lebensweltorientierte Soziale Arbeit (hrsg. zus. mit Klaus Grunwald, 2005, 2016). Seit 2002 ist Thiersch emeritiert, nach wie vor jedoch in vielen vorgenannten Feldern engagiert tätig.
Das Interview wurde am 23.08.2018 geführt
Sie finden hier folgende Videos:
[openVideo=fullvideo;Gesamtes Video]
[openVideo=Persönliches und Einstiegsfragen;Persönliches und Einstiegsfragen]
[openVideo=Kurzvorstellung;Kurzvorstellung]
[openVideo=Alltagswende;Alltagswende]
[openVideo=Handlungskonzept / Theorie der Lebensweltorientierung;Handlungskonzept / Theorie der Lebensweltorientierung]
[openVideo=Lebensweltbegriff;Lebensweltbegriff]
[openVideo=Aktualität der Theorie;Aktualität der Theorie]
[openVideo=Praxisbeispiel;Praxisbeispiel]
[openVideo=Die Vorderbühne des Alltags und die gesellschaftlichen Strukturen;Die Vorderbühne des Alltags und die gesellschaftlichen Strukturen]
[openVideo=Das sozialpädagogische Jahrhundert;Das sozialpädagogische Jahrhundert]
[openVideo=Blick in die Zukunft;Blick in die Zukunft]
[openVideo=Vielfältigkeit der Theorien;Vielfältigkeit der Theorien]
W

Wolf Rainer Wendt
Wolf Rainer Wendt (*1939) studierte Philosophie, Psychologie, Soziologie und Kunstgeschichte in Tübingen und Berlin mit dem Abschluss Dipl. Psychologe und promovierte 1969 in Tübingen. Nach Tätigkeiten in der Erziehungsberatung und Abteilungsleitung im Jugendamt Stuttgart übernahm Wendt 1978 die Leitung des Ausbildungsbereiches Sozialwesen an der Berufsakademie Stuttgart (jetzt Duale Hochschule Baden-Württemberg). 1989 war er Mitbegründer der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit und seit 1994 für viele Jahre ihr Vorsitzender. Wendt wurde 2004 emeritiert. Von 2004 bis 2015 war Wendt Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Care und Case Management (DGCC) und ist seit 2003 Honorarprofessor an der Universität Tübingen, Institut für Erziehungswissenschaft. Wendts Publikationstätigkeit kennzeichnet eine ausgesprochen hohe Vielzahl von Veröffentlichungen, darunter 22 Monographien, insbesondere zum ökosozialen Handlungsmodell, zur Sozialwirtschaft und zum Case Management sowie zur Geschichte Sozialer Arbeit.
Wendt steht für den ökosozialen Ansatz innerhalb der Theoriebildung der Sozialen Arbeit. Seine theoretischen Fundierungen hat Wendt besonders in seinem Buch Ökologie und Soziale Arbeit (1982) dargelegt und später in seinen Büchern Ökosozial denken und handeln (1990) und Das ökosoziale Prinzip (2010) näher konkretisiert. Mit dem Buch Wirtlich handeln in Sozialer Arbeit (2018) legte er eine Revision seiner ökosozialen Theorie vor.
Das Interview wurde am 12.09.2018 geführt
Sie finden unter folgendem Link ein Video zu einer aktuellen Diskussion (26.01.2023) mit Herrn Wendt: [openVideo=Sozialwirtschaft in der ökosozialen Transformation - Eine Online-Diskussion mit Prof. Dr. Wolf Rainer Wendt;Sozialwirtschaft in der ökosozialen Transformation - Eine Online-Diskussion mit Prof. Dr. Wolf Rainer Wendt]
Sie finden hier folgende Videos:
[openVideo=fullvideo;Gesamtes Video]
[openVideo=Persönliches und Einstiegsfragen;Persönliches und Einstiegsfragen]
[openVideo=Kurzvorstellung;Kurzvorstellung]
[openVideo=Oikos, ökosozialer Ansatz, Systemtheorien;Oikos, ökosozialer Ansatz, Systemtheorien]
[openVideo=Lebensführung und Lebensbewältigung;Lebensführung und Lebensbewältigung]
[openVideo=Was kann die Soziale Arbeit mit Ihrer Theorie anfangen? Ökosozialer vs. Psychosozialer Ansatz;Was kann die Soziale Arbeit mit Ihrer Theorie anfangen? Ökosozialer vs. Psychosozialer Ansatz]
[openVideo=Gemeinschaft, Gemeinwesen, Netzwerke, Solidarität;Gemeinschaft, Gemeinwesen, Netzwerke, Solidarität]
[openVideo=Was ist Soziale Arbeit?;Was ist Soziale Arbeit?]
[openVideo=Management / Wirtschaftlich handeln;Management / Wirtschaftlich handeln]
[openVideo=Herausforderungen der Sozialen Arbeit;Herausforderungen der Sozialen Arbeit]
[openVideo=Revision der eigenen Theoriebildung, Digitalisierung / International, Asien;Revision der eigenen Theoriebildung, Digitalisierung / International, Asien]
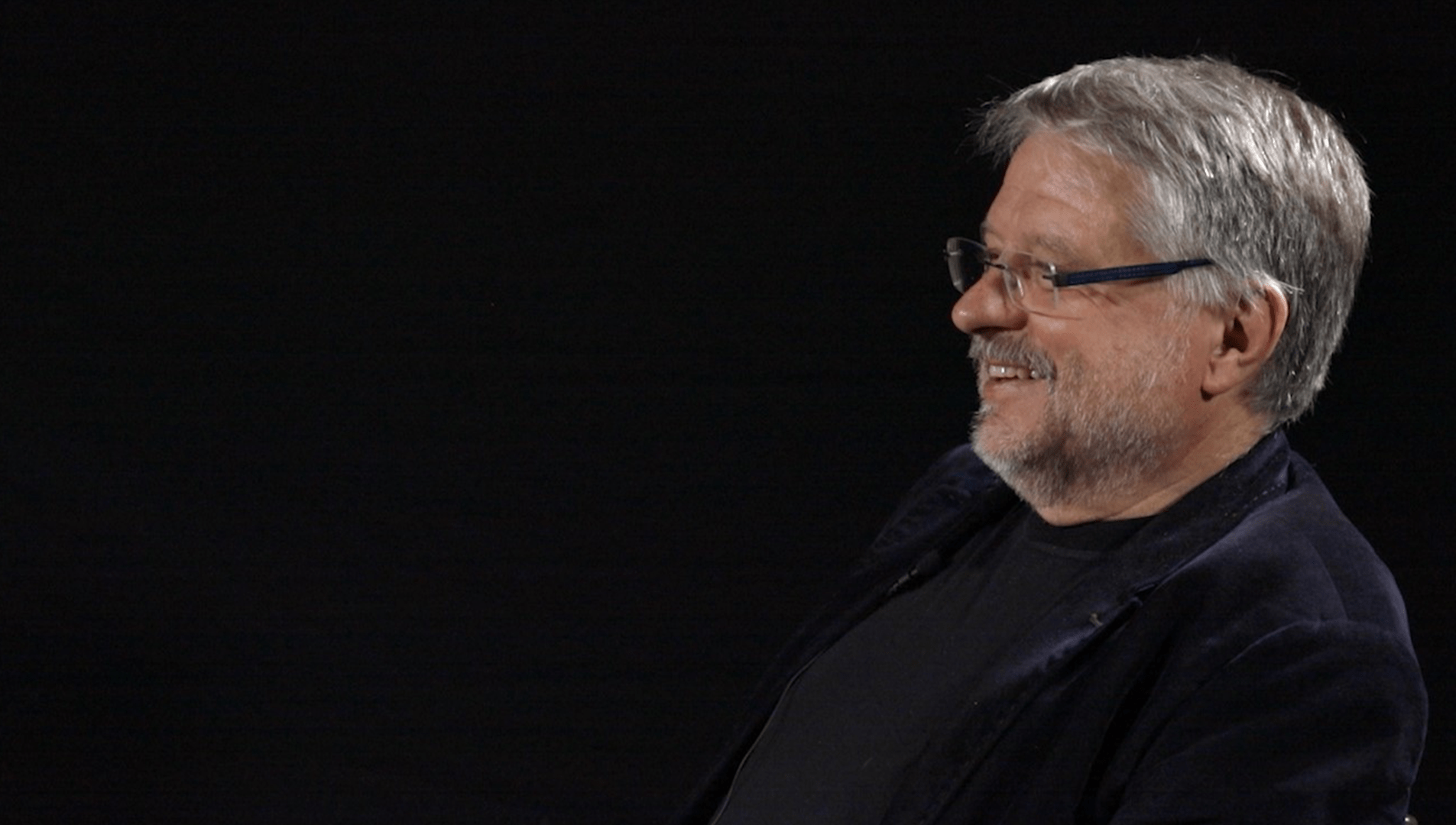
Michael Winkler
Michael Winkler (*1953) studierte Pädagogik, Germanistik, Neuere Geschichte und Philosophie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg wo er 1979 promovierte. 1986 habilitierte er mit seiner 1988 erschienenen Schrift „Eine Theorie der Sozialpädagogik“ an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Nach einer Gastprofessur für Allgemeine Pädagogik und ästhetische Erziehung an der Hochschule der Künste in Berlin (West) im Jahr 1987 bis 1988 erhielt Winkler ein Heisenberg-Stipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft. 1991 nahm er eine Lehrstuhlvertretung für Allgemeine Pädagogik und Medienpädagogik an der Universität Kiel wahr. Ein Jahr später übernahm Winkler eine Professur für Allgemeine Pädagogik und Theorie der Sozialpädagogik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. In den Jahren 2000 bis 2002 und 2004 bis 2005 war Winkler Direktor des Instituts für Erziehungswissenschaft an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und von 2008 bis 2016 Direktor des dortigen Instituts für Bildung und Kultur. Gastprofessuren führten Winkler an die Universität Graz (1991 bis 1993 mit dem Schwerpunkt Sozialpädagogik) und an die Universität Wien (1996 und 2006). Seit 2018 ist Winkler emeritiert.
Winkler vertritt einen subjekttheoretischen Ansatz in der Tradition der geisteswissenschaftlichen Pädagogik. Seine bisherigen Publikationen umfassen eine Vielzahl von monographischen Abhandlungen, Herausgeberwerken, und Fachbeiträgen in verschiedenen Fachzeitschriften und Sammelwerken. Seine 1988 erschienene Theorie der Sozialpädagogik wurde auch in polnischer Sprache publiziert (Pedagogika spoleczna. GWP Lodz).
Das Interview wurde am 20.09.2019 geführt
Sie finden hier folgende Videos:
[openVideo=fullvideo;Gesamtes Video]
[openVideo=Persönliches und Einstiegsfragen;Persönliches und Einstiegsfragen]
[openVideo=Kurzvorstellung;Kurzvorstellung]
[openVideo=Wissenschaftliche Gegenstandsbestimmung;Wissenschaftliche Gegenstandsbestimmung]
[openVideo=Ungenaue Wissenschaft;Ungenaue Wissenschaft]
[openVideo=Objektive Idee der Sozialpädagogik / Orte und Subjekt;Objektive Idee der Sozialpädagogik / Orte und Subjekt]
[openVideo=Konkrete Verhältnisse / System Soziale Arbeit;Konkrete Verhältnisse / System Soziale Arbeit]
[openVideo=Soziale Arbeit als Überraschungswissenschaft;Soziale Arbeit als Überraschungswissenschaft]
[openVideo=Wirkung der Theorie/Objektivierung/Subjekte;Wirkung der Theorie/Objektivierung/Subjekte]
[openVideo=Vorpädagogisches Element / Vertrauen in die Autonomie des Subjekts;Vorpädagogisches Element / Vertrauen in die Autonomie des Subjekts]
[openVideo=Modus der Differenz/Modus der Identität;Modus der Differenz/Modus der Identität]
[openVideo=Sinnhorizonte/Entwicklung/Gesellschaft;Sinnhorizonte/Entwicklung/Gesellschaft]
[openVideo=Soziale Strukturen / Erziehung gelingt;Soziale Strukturen / Erziehung gelingt]
[openVideo=Kritik der Inklusion;Kritik der Inklusion]

Jan Volker Wirth
Jan Volker Wirth (*1967) ist freiberuflicher Sozialarbeitswissenschaftler und Praxisberater in Einrichtungen des Sozialwesens. Nach dem Abschluss als Diplom-Sozialarbeiter an der Alice Salomon Hochschule Berlin studierte Wirth Soziologie im Postgraduierten-Studium an der Freien Universität Berlin und an der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Im Jahr 2013 wurde er dort zum Dr. phil. im Fach Soziologie mit dem Thema Lebensführung als Systemproblem. Entwurf einer Theorie der Lebensführung promoviert. Wirth lehrt als Gastprofessor und Dozent an zahlreichen Universitäten, Hochschulen, Fachhochschulen und Berufsakademien mit den Schwerpunkten Wissenschaft, Theorien und Methoden Sozialer Arbeit in Deutschland, Österreich und Polen. Wirth hat zahlreiche Veröffentlichungen zur systemischen Sozialen Arbeit verfasst und u.a. zusammen mit Heiko Kleve ein Lexikon zur systemischen Praxis, Methodik und Theorie herausgegeben. Ebenso mit Kleve arbeitet er an einer professionstheoretischen Begründung einer transdisziplinären Sozialarbeitswissenschaft (Kleve; Wirth 2013, Wirth; Kleve 2019). Seit 2015 ist Wirth Habilitand an der Universität Bielefeld/Pädagogische Hochschule Freiburg und seit 2019 als Professor an der privaten Diploma Hochschule (Hessen) in der Funktion des Studiendekans für das Fernstudium des Masterstudiengangs Psychosoziale Beratung in Sozialer Arbeit tätig. Wirth hat seine disziplin- und professionstheoretischen Untersuchungen besonders in den beiden Werken Die Lebensführung der Gesellschaft. Grundriss einer allgemeinen Theorie (2015) und zusammen mit Kleve Die Ermöglichungsprofession. 69 Leuchtfeuer für systemisches Arbeiten (2019) dargelegt.
Das Interview wurde am 23.08.2018 geführt
Sie finden hier folgende Videos:
[openVideo=fullvideo;Gesamtes Video]
[openVideo=Persönliches und Einstiegsfragen;Persönliches und Einstiegsfragen]
[openVideo=Kurzvorstellung;Kurzvorstellung]
[openVideo=Lebensführung - Teil 1;Lebensführung - Teil 1]
[openVideo=Lebensführung - Teil 2;Lebensführung - Teil 2]
[openVideo=Inklusion / Exklusion und Capabilty Approach;Inklusion / Exklusion und Capabilty Approach]
[openVideo=Herausforderungen;Herausforderungen]
[openVideo=Bezahlung von Sozialarbeiter_innen;Bezahlung von Sozialarbeiter_innen]
[openVideo=Zukunftsthemen;Zukunftsthemen]
